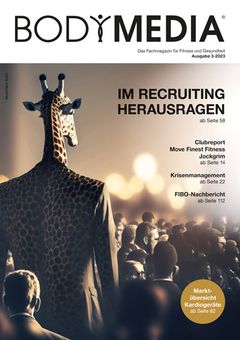Sofern bis zu dem neuen Endtermin keine fristgerecht eingereichten Schlussabrechnungen für die vorläufigen Bewilligungen vorliegen, sind von den jeweils zuständigen Bewilligungsstellen der Länder umgehend Rückforderungsmaßnahmen einzuleiten. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Schlussabrechnungen fristgerecht erstellt und eingereicht werden. Die Rechtslage rund um die Überbrückungshilfen entwickelt sich rasant weiter. Zu den ersten anhängigen Verfahren liegen nun Urteile vor. Der Artikel wird ein allgemeines Verständnis von den Überbrückungshilfen verschaffen sowie einen Einblick in den Stand der aktuellen Verfahren liefern.
Was sind die Überbrückungshilfen?
Die Überbrückungshilfen, auch bekannt als Corona-Hilfen, sind ein einheitliches Bundesprogramm in Zusammenarbeit mit den 16 Bundesländern. Dieses Programm wurde infolge der im März 2020 von der EU-Kommission verabschiedeten Entscheidung zur Unterstützung von Beihilfen umgesetzt. Die EU-Kommission traf diese Entscheidung aufgrund des Ausbruchs von COVID-19. Sie legte dar, unter welchen Voraussetzungen bestimmte Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt vereinbar waren und welche Optionen den Mitgliedsstaaten gemäß den EU-Vorschriften zur Unterstützung kleiner und mittelständischer Unternehmen aufgrund des plötzlichen finanziellen Engpasses zur Verfügung standen. Dazu gehörte die befristete Bereitstellung eines Beihilferahmens, auf dessen Basis unter einem festgelegten Höchstbetrag eine Fixkostenhilfe gewährt werden konnte.
An dieses Hilfsprogramm schloss sich von März bis Mai 2020 das weitere "Corona-Soforthilfe"-Programm an, bekannt als Überbrückungshilfe I. Von September bis Dezember 2020 wurde eine fortgesetzte Gewährung der Überbrückungshilfe im Rahmen der Richtlinien der jeweiligen Länder durchgeführt, die als Überbrückungshilfe II bekannt ist. Die Überbrückungshilfe I war für kleine und mittelständische Unternehmen gedacht, deren Schlussabrechnungsfrist am 31.10.2023 endete. Die Überbrückungshilfe II ist die zweite Förderphase der Überbrückungshilfe I und ebenfalls eine "Corona-Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen". Die Überbrückungshilfe III war ein Fixkostenzuschuss. Die Überbrückungshilfe IV sollte die Anspruchsberechtigten im Zeitraum Januar bis Juni 2022 durch die Bundesregierung unterstützen. Die Bedingungen entsprachen weitgehend denen der Überbrückungshilfe III.

Am 31.10.2023 endete die Einreichungsfrist der Schlussabrechnung der Corona-Hilfen. Eine Schlussabrechnung über die Liquiditätsengpässe ist bis spätestens zum 30.09.2024 einzureichen (Bildquelle: © ImageSine - stock.adobe.com)
Darunter zu verstehen sind gewährte Förderungen der Bundesregierung zur Überwindung von Liquiditätsengpässen, die mit einem Schlussbescheid vollständig zurückgefordert werden können. Am 31.10.2023 endete die Einreichungsfrist der Schlussabrechnung der Corona-Hilfen. Eine Schlussabrechnung über die Liquiditätsengpässe ist bis spätestens zum 30.09.2024 einzureichen. Zuständig ist die jeweilige Bewilligungsstelle.
Was ist die Schlussabrechnung?
In der Coronazeit wurden die Überbrückungshilfen sowie die November- und Dezemberhilfen, die über einen prüfenden Dritten eingereicht wurden, zumeist auf der Grundlage von Umsatzprognosen und prognostizierten Kosten bewilligt. Letztendlich liegen mittlerweile die genauen Zahlen bei den Unternehmen vor, sodass durch die prüfenden Dritten auf Basis von tatsächlichen Umsatzahlen und Fixkosten eine sogenannte Schlussrechnung zu erstellen ist. Nachdem die Bewilligungsstelle diese Schlussabrechnung im Antrag überprüft hat, wird in einem Schlussbescheid die finale Förderhöhe mitgeteilt.
Als prüfende Dritte können folgende Organe die Schlussabrechnungen erstellen und bei der Bewilligungsstelle einreichen:
- Eingetragene Steuerberater
- Wirtschaftsprüfer
- Vereidigte Buchprüfer
- Rechtsanwälte
Überbrückungshilfen – aktueller Stand der laufenden Verfahren
Die Überbrückungshilfe ist eine Billigkeitsleistung, die sich aus den jeweiligen Haushaltsordnungen der Bundesländer ableitet. Der einzelne Antragsberechtigte hat keinen Rechtsanspruch auf diese Leistung. Die Tatsache, dass es sich um Billigkeitsleistungen handelt und nicht um gesetzliche Schadenersatzansprüche, erschwert die gerichtliche Geltendmachung. Die Gerichte haben einen nur sehr eingeschränkten Prüfungsmaßstab, der sich im Wesentlichen auf die ständige Verwaltungspraxis der Behörde reduziert.
Die Zuwendung erfolgt auf der Grundlage der jeweils einschlägigen Förderrichtlinie und der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen in den Bundesländern. Die Leistung wird im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel des jeweiligen Landeshaushalts gewährt. Ausnahmsweise besteht ein Rechtsanspruch, wenn die Verwaltung in vergleichbaren Fällen eine Zuwendung vorgenommen hat. Bei der Beurteilung im Subventionsrecht kommt es auf den Zeitpunkt der Entscheidung der Bewilligungsstelle an.
Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg (Urteil vom 14.11.2022 – W 8 K 22.95) verdeutlicht, dass ein Anspruch auf Förderung im Einzelfall über den Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung und den Gleichheitssatz begründet werden kann. Dies setzt jedoch voraus, dass die in den Richtlinien dargelegten Fördervoraussetzungen vorliegen und in der ständigen Verwaltungspraxis entsprechend positiv beschieden wurden. Förderrichtlinien dürfen nicht gerichtlich ausgelegt werden. Lediglich mögliche Verstöße gegen den Gleichheitsgrundsatz im Rahmen der Ermessensausübung der Behörde sind Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung.
Die rechtliche Beurteilung staatlicher Fördermaßnahmen, die nicht auf Rechtsnormen, sondern lediglich auf verwaltungsinternen ermessenslenkenden Vergaberichtlinien beruhen, richtet sich danach, wie die ministeriellen Vorgaben von der zuständigen Stelle tatsächlich verstanden und praktiziert wurden. In einem zitierten Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Würzburg ging es um Fragen eines verbundenen Unternehmens. Da aufgrund der Billigkeitsleistung der Überbrückungshilfen kein Rechtsanspruch besteht, obliegt es allein dem Zuwendungsgeber, die Modalitäten einer Förderung festzulegen, seine Richtlinien auszulegen und den Förderzweck zu bestimmen. Auf die übliche Auslegung kommt es nicht an.
Trotz bundeseinheitlicher Förderprogramme gibt es keine allgemeingültige Anspruchsnorm. Ein Anspruch kann sich lediglich aus der Gestaltung der Förderrichtlinie durch den Zuwendungsgeber oder aus dem Grundsatz der Selbstbindung der Verwaltung in vergleichbaren Fällen ergeben. Die gerichtliche Geltendmachung bleibt schwierig, wenn der Nachweis fehlt, dass die Behörde in anderen Fällen die Überbrückungshilfe gewährt hat.
Bildquelle Header: © MQ-Illustrations - stock.adobe.com