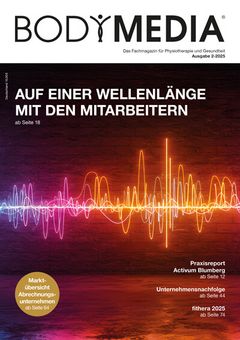Das Wichtigste in Kürze
- Ein Praxisverkauf gelingt am besten, wenn Abgeber und Erwerber sich ausreichend Zeit nehmen – üblicherweise mindestens ein halbes Jahr – um Kaufvertrag, Finanzierung und Übergabe sorgfältig vorzubereiten.
- Der Kaufpreis sollte realistisch ermittelt werden und sowohl den materiellen Wert der Praxis als auch den immateriellen Goodwill berücksichtigen.
- Alle betrieblichen Unterlagen, Mietverträge und Dauerverträge müssen gut vorbereitet und geprüft sein, da sie entscheidend für den Wert der Praxis und die Finanzierbarkeit sind.
- Datenschutz und Patientenakten sind streng geregelt: Sowohl Papier- als auch elektronische Daten dürfen nur unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben übergeben werden.
- Die Mitarbeiter sollten frühzeitig eingebunden werden, um Abgänge zu vermeiden und einen reibungslosen Betriebsübergang (§ 613a BGB) sicherzustellen.
- Besondere Aspekte wie ausgelagerte Fitnessbereiche, Gemeinschaftspraxen oder Praxen in GmbH-Form erfordern zusätzliche rechtliche Prüfung und Due Diligence, um Überraschungen beim Verkauf zu vermeiden.
Eine Praxis kann notfalls innerhalb weniger Wochen verkauft werden – die Übergabe gelingt aber viel besser (und zu einem höheren Kaufpreis), wenn sich Abgeber und Erwerber wenigstens ein halbes Jahr Zeit nehmen. Denn natürlich ist nicht nur der Praxiskaufvertrag zu entwerfen und zu verhandeln, sondern dieser ist auch Grundlage für die finanzierende Bank des Erwerbers – und allein die Banken prüfen oft mehrere Wochen.
Den richtigen Kaufpreis ermitteln
Teil des Praxisverkaufvertrages ist natürlich der Kaufpreis. Für die Kaufpreisermittlung ist es sinnvoll, die Methoden anzuwenden, die auch finanzierende Banken zugrunde legen – denn ohne Finanzierung hilft der schönste Vertrag nichts. Maßgeblich ist hier die sogenannte modifizierte Ertragswertmethode: Zunächst wird der materielle Wert ermittelt, das ist der Wert aller Praxisgegenstände. Diese Information hält der Steuerberater bereit (Achtung, wenn hier etwa auch der privat genutzte Pkw enthalten ist. Der muss natürlich abgezogen werden).
Hinzu kommt der sogenannte immaterielle Wert, der Goodwill. Vereinfacht gesagt fragt man sich, wie lange ein Erwerber vom guten Ruf des Abgebers, von dessen Lebenswerk, profitiert (oder ob es für ihn nicht besser wäre, eine Praxis neu zu gründen). Dafür nimmt man den durchschnittlichen Umsatz der letzten drei Jahre und zieht die durchschnittlichen Praxiskosten ab. Von diesem Zwischenergebnis wird ein fiktives Gehalt abgezogen (was der Erwerber ja als Angestellter ohne jedes Risiko erhalten könnte – und von irgendetwas muss der Erwerber auch leben).
Der Restbetrag wird nun mit einem Faktor addiert – dieser ist größer, je weniger der gute Ruf vom Inhaber selbst abhängt: Handelt es sich um eine Praxis mit mehreren Standorten, umfangreicher Vernetzung, Versorgung in Altenheimen usw., wird sich der Weggang des Praxisinhabers viel weniger auf den zukünftigen Umsatz auswirken als bei einer Kleinpraxis mit zwei Angestellten. Er liegt oft zwischen zwei und drei, kann aber auch höher liegen. Schließlich wird noch der materielle Wert addiert.

Beim Praxisverkauf darf das in ein anderes Unternehmen verlagerte Fitnessbereich nicht vergessen werden; auch werden dort oft ebenfalls Mitarbeiter beschäftigt (Bildquelle: © Drazen – stock.adobe.com)
Hier eine beispielhafte Rechnung: Praxisumsatz 250.000 € im Durchschnitt der letzten drei Jahre. Praxisausgaben (Mitarbeiter, Miete …) durchschnittlich 120.000 €. Bleibt eine Differenz von 130.000 €. Hiervon muss ein fiktives Gehalt (Arbeitgeberbrutto) des Käufers abgezogen werden, denn wenn der nicht von der Praxis leben kann, wird ihm niemand einen Kredit geben. Setzen wir hierfür 60.000 € an. Bleiben 70.000 € Goodwill. Aus der (fiktiven) Praxissituation ergibt sich ein Faktor 2, d. h. der immaterielle Wert würde 140.000 € betragen. Hinzu kommt der materielle Wert von beispielsweise 30.000 € – und damit ein Kaufpreis von 170.000 €.
Einblick in betriebliche Unterlagen
Teil des Verkaufsprozesses ist es natürlich, Interessenten Einblick in betriebliche Unterlagen, etwa die BWA der letzten Jahre, aber auch Arbeitsverträge, Mietverträge usw. zu gewähren. Diese sollten gut vorbereitet sein. Häufig ist eine Verschwiegenheitsverpflichtung für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern, angebracht.
Oft übersehener Faktor: der Praxismietvertrag
Ein lange, häufig zehn Jahre, laufender Mietvertrag übersteigt in seiner wirtschaftlichen Bedeutung den Praxiskaufpreis häufig. Die Praxisräume sind gerade bei Physiotherapiepraxen neben den Mitarbeitern der zentrale wertbildende Faktor. Der Übertragung des Mietvertrages kommt daher für einen erfolgreichen Praxisverkauf eine entscheidende Bedeutung zu. Aus diesem Grund finanzieren viele Banken Praxiserwerber nicht, wenn sie nicht einen mindestens zehn Jahre laufenden Mietvertrag mit dem Vermieter nachweisen können.
Es ist daher auch für den Praxisabgeber enorm wichtig, den Vermieter rechtzeitig mit ins Boot zu holen und auch dessen Pläne (etwaige Mieterhöhungen?) zu erfahren. Keinesfalls darf der Mietvertrag einfach durch den Abgeber gekündigt werden, dies würde den Wert der Praxis massiv schmälern. In einer dreiseitigen Vereinbarung (Verkäufer, Käufer, Vermieter) sind zudem für den Praxisabgeber wichtige Aspekte, wie etwa die Übertragung von Rückbauverpflichtungen, vorzunehmen.
Patientendatenschutz beachten
Die Übergabe der Patientenkartei ist datenschutzrechtlich streng geregelt, sowohl für die papiergebundene Datei als auch für die elektronische Kartei. Entwickelt wurde hierfür das sog. „Zwei-Schrank-Modell“, das man sich tatsächlich wie einen alten Hängeregisterschrank vorstellen kann: Der Praxisabgeber schließt den Schrank ab und der Erwerber darf ihn nur aufschließen, wenn Patienten der Einsichtnahme ausdrücklich zugestimmt haben.
So einfach dies bei der papiergebundenen Patientenakte ist, um so komplexer wird der gleiche Vorgang bei der Praxissoftware. Allein die Rücksprachen mit den Softwareanbietern dauern oft Wochen. Auch dürfen natürlich Mailpostfächer nicht einfach übergeben werden, sondern unterliegen den gleichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Praxisabgeber sind gut beraten, dieses Thema ernst zu nehmen: Denn verstößt man bei der Praxisübergabe gegen Datenschutzbestimmungen, ist der Kaufvertrag nichtig (§ 134 BGB, § 203 StGB).
Dauerschuldverhältnisse übertragen
Dauer… was? Gemeint sind alle relevanten auf die Praxis lautenden Verträge. Die Mitarbeiter sollten kommunikativ gut in den Praxisverkauf eingebunden werden, damit nicht plötzlich Absetzbewegungen in andere Praxen beginnen, die den Praxiswert massiv schmälern würden. Denn eine Einzelpraxis geht nicht im Wege der sogenannten „Gesamtrechtsnachfolge“ (wie bei einem Erbe) auf den Käufer über – vielmehr werden nur solche Verträge (von der betrieblichen Altersvorsorge bis zur Telekom) übertragen, die einzeln aufgezählt werden.
Alle anderen Verträge bleiben sonst beim Praxisabgeber – selbst wenn der schon gar keine Einnahmen mehr hat. Umgekehrt darf auch nicht zu viel übertragen werden – sonst ist das eigene Auto, das formal auf die Praxis läuft, plötzlich beim Erwerber.
Mitarbeiter richtig mitnehmen & Betriebsübergang gestalten
Praxen mit einem guten Mitarbeiterstamm haben kaum Probleme, einen Käufer zu finden – die Mitarbeiter sind (neben dem Mietvertrag) der wertbildende und natürlich auch der umsatzbringende Faktor. Sie müssen daher kommunikativ gut eingebunden werden, damit nicht plötzlich Absetzbewegungen in andere Praxen beginnen, die den Praxiswert massiv schmälern würden
Zugleich gibt es auch einige rechtliche Aspekte zu beachten: Praxisabgeber und Praxiserwerber müssen gemeinsam einen sog. Betriebsübergang (§ 613a BGB) gestalten. Denn das Gesetz fordert einige Informationen gegenüber den Mitarbeitern und gewährt diesen einen gesonderten Kündigungsschutz. Vor allem aber können Mitarbeiter der Überleitung des Arbeitsverhältnisses auf den Praxiserwerber widersprechen. Das kommt zwar nur selten vor, aber wenn ein langjährig beschäftigter Mitarbeiter widerspricht, muss der Praxisabgeber diesen bis zum Ablauf der mehrmonatigen Kündigungsfrist weiterbeschäftigen, obwohl dem gar keine Praxiseinnahmen mehr gegenüberstehen.

Die Mitarbeiter sollten kommunikativ gut in den Praxisverkauf eingebunden werden, damit nicht plötzlich Absetzbewegungen in andere Praxen beginnen, die den Praxiswert massiv schmälern würden (Bildquelle: © jovannig – stock.adobe.com)
Aus Sicht von Praxisabgebern ist es sinnvoll, keine Garantien zu geben – außer für die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen. Allein dies ist aufwendig. Häufig verlangen Erwerber aber umfangreiche Garantien, etwa dass der Urlaub von Mitarbeitern genommen wurde, diese keine Überstunden haben (damit der Erwerber diese nicht gewähren muss), dass Geräte gewartet wurden usw. Spätere Gerichtsverfahren, wenn der Erwerber meint, dass der Abgeber gegen von ihm gegebene Garantien verstoßen habe, sind äußerst nervig.
Vermeintliche juristische Kleinigkeiten
Aus der anwaltlichen Perspektive gibt es darüber hinaus diverse juristische Kleinigkeiten, die im Falle des Falles aber große Wirkung haben können. Dazu gehören etwa aufschiebende Bedingungen, d. h. dass die Praxis wirklich nur dann als verkauft gilt, wenn der Kaufpreis auch tatsächlich geflossen ist. Auch die Berufsunfähigkeit oder der plötzliche Tod des Erwerbers, wie auch des Veräußerers, müssen mitbedacht werden.
Fitnessbereich nicht vergessen
Physiotherapeuten betreiben oft einen Fitnessbereich und haben diesen aus steuerlichen Gründen in ein zweites Einzelunternehmen ausgelagert. Beim Praxisverkauf darf dieses Unternehmen nicht vergessen werden; auch werden dort oft ebenfalls Mitarbeiter (etwa als Minijobber) beschäftigt.
Zu guter Letzt: Sonderfälle
Anteilsübertragung in einer Gemeinschaftspraxis oder einer Physio-GmbH: Ganz andere Aspekte sind beim Verkauf eines Gesellschaftsanteils an einer Gemeinschaftspraxis (etwa in der Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts) oder einer Physio-GmbH zu beachten. Während hierbei manche Aspekte einfacher sind, etwa der Datenschutz und der Betriebsübergang der Mitarbeiter, handelt es sich rechtlich um völlig verschiedene Vertragstypen. Während beim Verkauf einer Einzelpraxis mögliche Absetzungen oder sonstige Schulden beim Praxisabgeber bleiben, gehen diese bei einem Anteilsübernahmevertrag vollständig auf den Erwerber über. Praxiserwerber werden daher auf eine viel detailliertere Prüfung der Verträge, Forderungen, Absetzungen usw. (Due Diligence) bestehen.
Bildquelle Header: © whitestorm – stock.adobe.com