Wenn Sie die Frage, ob Sie sich von der Arbeit erschöpft fühlen, mit „ja“ beantworten, sind Sie in guter Gesellschaft. Rund die Hälfte befragter deutscher Arbeitnehmer hat diese Frage ebenfalls bejaht. Ein Grund ist, dass viele ihren Job als sinnlos ansehen. Eine Ursache der Erschöpfung kann allerdings auch in der permanenten Erreichbarkeit, dem permanenten Wechseln zwischen Aufgaben sowie häufigen Störungen und Unterbrechungen liegen – sprich: dem „Multitasking“.
Das Ausmaß, wie ausgeprägt Multitasking betrieben wird, hängt dabei nicht unerheblich von den eigenen Nutzungsgewohnheiten des Smartphones ab.
Fokus ist unerlässlich
Permanente Erreichbarkeit und die Politik der „offenen Tür“ werden von vielen Führungskräften und auch Mitarbeitern propagiert und gelebt. Wer jedoch über 100 Aktivierungen pro Tag in seinem Nutzungsverhalten ausprägt, entsperrt sein Smartphone bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 12 Stunden fast zehnmal pro Stunde – also alle sechs Minuten.
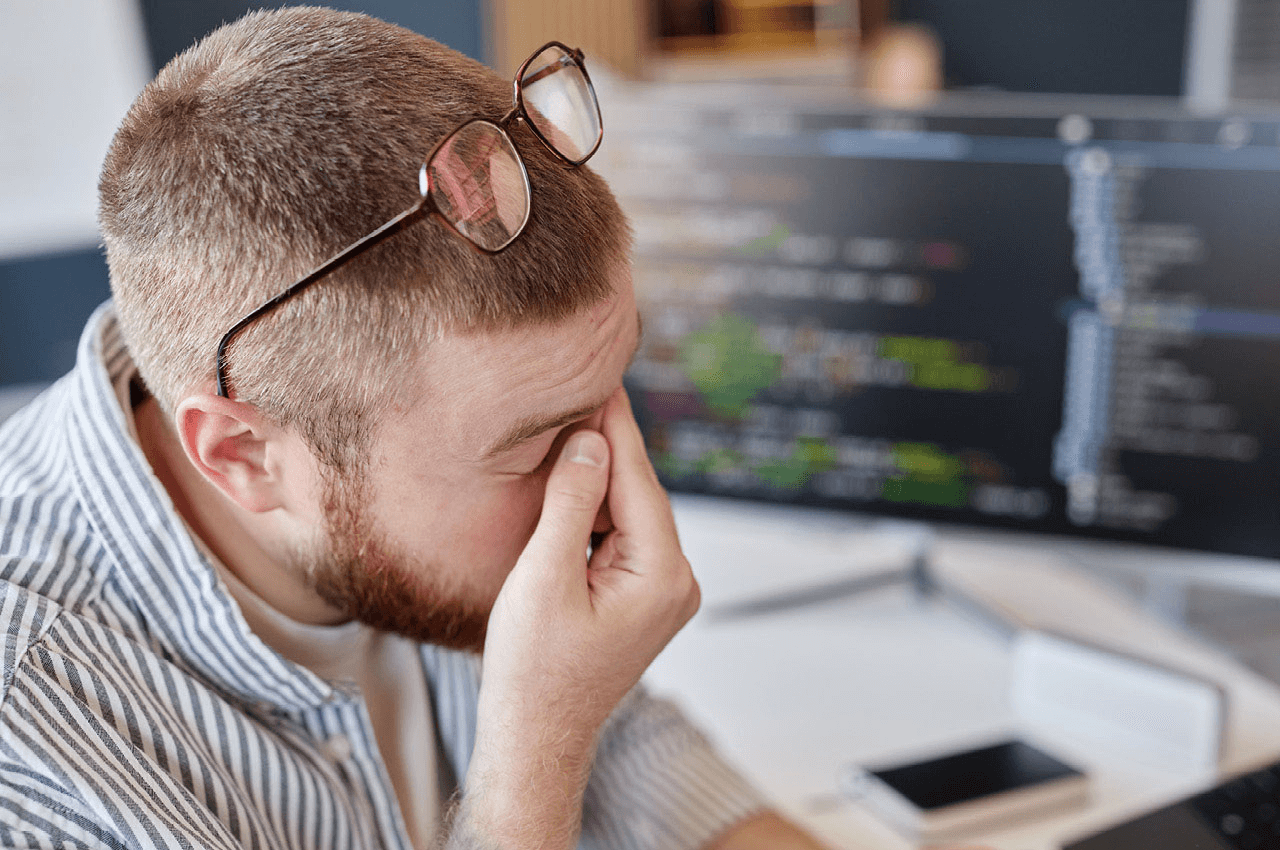 Rund die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich von ihrer Arbeit erschöpft (Bildquelle: © Seventyfour – stock.adobe.com)
Rund die Hälfte der deutschen Arbeitnehmer fühlen sich von ihrer Arbeit erschöpft (Bildquelle: © Seventyfour – stock.adobe.com)
Das zerstört den Fokus und vermindert unsere Denkleistung, also die Grundlage allen Erfolgs, den wir anstreben. Bevor wir uns den wissenschaftlichen Belegen und den möglichen Lösungsansätzen zuwenden, sei ein kurzer Ausblick auf die Relevanz von fokussiertem Arbeiten vorangestellt.
1993 hat eine Forschergruppe um Ericsson et al. in einem weltweit beachteten, heute noch gültigen Artikel festgestellt, was Lernen neuer und komplizierter Fertigkeiten bedarf:
- Konzentration und Fokus
- Wiederholung
- Feedback
Am Beispiel eines Klavierspielers lässt sich dies sehr gut darstellen. Der lernende Klavierspieler muss während seiner Übung den Fokus komplett auf diese legen. Er muss diese Übung immer und immer wieder durchführen. Und er braucht Feedback, ob er die Übung und die zu erlernende Technik richtig durchgeführt hat oder ob er seine Technik umstellen muss.
In einer Zeit, in der sich u. a. die Themen der „Künstlichen Intelligenz“ rapide nahezu jeden Tag ändern, ist es umso wichtiger, sich neuen Ideen zur Weiterentwicklung zu widmen oder der Beste seines Fachs zu werden sowie zu bleiben. Und dabei ist der Fokus unerlässlich. Wie viel Zeit man dem fokussierten Arbeiten zuteilt, ist die letzte Variable in dieser Formel zur hochqualitativen Arbeit.
Je intensiver der Fokus und je mehr Zeit für fokussiertes Arbeiten aufgebracht wird, desto höher ist das Ergebnis. Allerdings gibt es auch eine Grenze: Maximal vier Stunden pro Tag sollten für fokussiertes Arbeiten eingeplant werden (Newport, 2016).
Auch interessant: Erfolgreiche Kommunikation im Fitnessstudio: Strategien für Mitglieder- und Teambindung
Die Voraussetzung für fokussiertes Arbeiten sind Aufmerksamkeit und Konzentration als dessen Teilaspekt. Aufmerksamkeit hat grundlegend drei Funktionen: Filtern von Reizen, Zuwendung zu bestimmten Inhalten und Dingen sowie Ausblendung von Ablenkung (Spitzer, 2015). Daraus bilden sich also drei Aufmerksamkeitsnetzwerke (Rietzler, 2024):
- Das „Alerting“-Netzwerk, bei dem wir auf einen Reiz in der Umwelt wachsam werden, z. B. das Party-Phänomen, wenn der eigene Name fällt und man diesen sehr gut heraushören kann.
- Das Orientierungsnetzwerk, bei dem wir die Lokalisierung eines Reizes feststellen.
- Die exekutive Kontrolle bzw. selektive Aufmerksamkeit, bei der man freiwillig seine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Inhalt richtet.
Smartphone als Störenfried
Ein Smartphone bindet Aufmerksamkeit, wenn es klingelt. Das dürfte niemanden verwundern. Das Klingeln unterbindet damit aber auch, dass Informationen, die einem zugespielt werden, nicht aufgenommen werden. So hat die Forschergruppe um End et al. (2009) dies an Studierenden erforscht. Diese waren angehalten, während eines Lehrvideos Notizen zu machen, sowie nach dem Video einen Auswahlfragentest zu absolvieren. In diesem bezogen sich Testfragen auf Inhalte bestimmter Zeitpunkte.
In der Versuchsgruppe wurde während des Videos an zwei Zeitpunkten ein Telefon sechs Sekunden klingeln gelassen. Die Kontrollgruppe konnte das Video ungestört anschauen. Das Fazit: In der Versuchsgruppe wurden eine signifikant geringere Aufmerksamkeit und eine geringere Gedächtnisleistung festgestellt. Das Umstellen auf Vibration oder Lautstärkenreduktion reicht nicht aus. Die bloße Störung reicht schon, um die Aufmerksamkeit zu verlieren.
Mittlerweile kann man bereits von einer Smartphone-Denkstörung sprechen, da die Smartphone-Nutzung die kognitive Leistungsfähigkeit beeinträchtigt (Spitzer, 2015). Skowronek, Seifert & Lindberg (2023) haben untersucht, wie sich die bloße Präsenz des Smartphones auf die Aufmerksamkeit auswirkt. Über einen standardisierten Test haben die Forscher drei Gruppen auf Schnelligkeit, Genauigkeit und Fehlerausprägung untersucht.
 Externe Belastung verhindert das tiefe, konzentrierte Arbeiten. Die wohl größte externe Belastung ist das Smartphone (Bildquelle: © Seventyfour – stock.adobe.com)
Externe Belastung verhindert das tiefe, konzentrierte Arbeiten. Die wohl größte externe Belastung ist das Smartphone (Bildquelle: © Seventyfour – stock.adobe.com)
Die Gruppen wurden eingeteilt in eine Gruppe, die ohne Smartphone die Untersuchung angetreten ist, eine Gruppe, deren Smartphone ausgeschaltet und umgedreht auf den Tisch gelegt wurde, und eine Gruppe, bei der die Smartphones ausgeschaltet in einem anderen Raum lagen. Die Ergebnisse waren eindeutig.
Die Gruppen ohne Smartphone waren signifikant aufmerksamer. Die Gruppe, deren Smartphone während der Untersuchung umgedreht auf dem Tisch lag, hat deutlich langsamer die Testfrage beantwortet.
Multitasking oder doch nicht?
Multitasking wird von vielen als möglich und teilweise auch wünschenswert angesehen. Der Mensch kann allerdings keine Handlungen simultan ausführen, die gerichtete Aufmerksamkeit benötigen. Davon ausgenommen sind automatisierte Handlungen, wie z. B. das Gehen. Was heutzutage als Multitasking angesehen wird, ist in Wahrheit ein Task-Switching.
Hierbei teilt man seine Aufmerksamkeit und belastet seine kognitiven Ressourcen in nicht unerheblichem Maße. Ein Teil der Aufmerksamkeit bleibt bei der unterbrochenen Aufgabe, während man zu der neuen Aufgabe wechselt. Diese kann dann nicht mit völligem Fokus angegangen werden.
Wechselt man danach zur alten Aufgabe zurück, entsteht dort dieselbe Wirkung. Konzentration erfordert nun einen hohen Energieaufwand, die kognitiven Ressourcen werden stärker belastet, das Endergebnis ist nicht so gut, wie es sein könnte, und am Ende des Tages fühlt man sich platt.
Auch hier wurden entsprechende Studien veröffentlicht. In einer Untersuchung von Ellis et al. (2010) wurde festgestellt, dass Studierende eine um 30 % geringere Erinnerungsleistung haben, wenn sie während einer Vorlesung Nachrichten schreiben. Hierfür wurde die Kontrollgruppe herangezogen, die nur der Vorlesung gefolgt ist.
Eine vierstündige Beobachtung von Studierenden hat ergeben, dass die Art der Lernorganisation und Lernumgebung erhebliche Auswirkungen auf den Lernerfolg und die Konzentration am Stück hat (Rosen et al., 2013). Hier wurde dokumentiert, dass es eine positive Korrelation der Anzahl geöffneter Tabs im Browser mit Ablenkung gibt. Je mehr Tabs geöffnet sind, desto abgelenkter waren die Studierenden. Ohne Strategie zu lernen, führte auch zu deutlich mehr Aufgabenwechseln.
Insgesamt lag die gerichtete Konzentration im Schnitt unter sechs Minuten. In einer weiteren Untersuchung haben Buser & Peter (2012) ebenfalls herausgefunden, dass Task-Switching die Leistung verschlechtert. Auch das Argument, Probleme mit einem frischen Blick zu sehen, wenn man zwischen Aufgaben wechselt, wurde in dieser Untersuchung widerlegt. Genauso wie der Mythos, dass Frauen Multitasking können bzw. eher zum Task-Switching tendieren.
Bessere Ergebnisse durch zielgerichtetes Arbeiten
Durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass durch einen gezielten Einsatz von fokussiertem, zielgerichtetem Arbeiten und der Vermeidung externer Störfaktoren bessere Ergebnisse erzielt werden können. Drei Tipps sollen Ihnen dabei helfen, den Anfang zu machen:
- Ausmaß der Ablenkung erkennen
Wie zu Beginn des Artikels angeführt, hilft es, sich regelmäßig einen Eindruck über die eigenen Nutzungsgewohnheiten des Smartphones zu machen. Wird erkannt, dass das Smartphone zu oft sinnfrei entsperrt wird, gilt es, dies zu korrigieren. Gleichzeitig empfehle ich, ein Journal zu führen, wann man Aufgaben wechselt und wie oft man während einer Aufgabe das Bedürfnis hat, das Smartphone in die Hand zu nehmen. Gerne den Zweck der Hinwendung an das Smartphone aufführen. Ist es eine dringende Nachricht der Familie? Oder war die Verlockung, das unbequeme, fokussierte Arbeiten zu verlassen, zu groß? - Tages- und Wochenplanung durchführen
Die Studienlage hat gezeigt, dass Ablenkung und Aufgabenwechsel oft dann erfolgen, wenn es keinen gerichteten Fokus gibt. Gerichtet kann der Fokus auch nur dann sein, wenn ich weiß, was ich tun möchte. Daher plädiere ich dafür, sich am Beginn eines Tages zu überlegen, was erreicht werden soll und entsprechende Zeitblöcke einzuplanen. Das hilft, den Fokus richtig zu setzen. Zudem kann auch den Mitarbeitern und Kollegen klar signalisiert werden: Ich bin beschäftigt und möchte in diesem Zeitraum nicht gestört sein. Hier maximal vier Stunden pro Tag fokussierte, ungestörte Arbeit ansetzen. Eine Stunde reicht zum Beginn, um sich eine Gewohnheit zu schaffen. - In Bewegung nachdenken
Die besten Ideen für Artikel, Keynotes und andere Projekte erhalte ich, wenn ich in Bewegung nachdenke. Meist kommen die besten Einfälle beim Joggen oder Spazieren. Von Aktivitäten, die zu viel Aufmerksamkeit erfordern, rate ich ab. Wichtig ist, dass man mit einer Fragestellung oder einem Projekt in die Aktivität geht, um das Unterbewusstsein für sich arbeiten zu lassen. Sie werden sehen, was dies für kreative Prozesse freisetzen kann!
Bildquelle Header: © Seventyfour – stock.adobe.com




