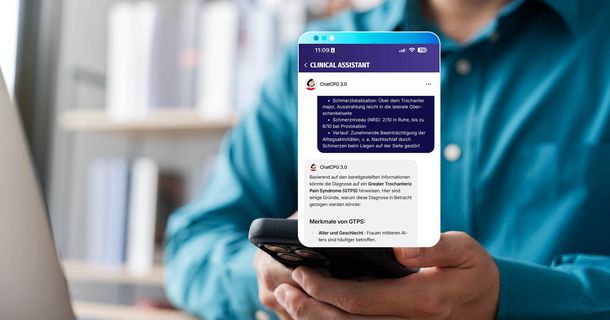Posttherapeutische Beschwerden können aus unterschiedlichen Gründen vorgetragen werden: Ob die Erwartungshaltung des Patienten schlicht eine andere war („Ich dachte, nach der Behandlung ist sofort alles wieder gut“) oder ob sich später gewisse Beschwerden beim Patienten einstellen, es kann nicht unmittelbar von einem therapeutischen Behandlungsfehler ausgegangen werden, nur weil der Patient temporär „mehr Schmerzen hat als vorher“. Und ja, je nach Sportlichkeit und körperlicher Verfassung des einzelnen Patienten kann es durchaus vorkommen, dass nach manchen Mobilitätsbehandlungen oder auch Eigenübungen, die der Physiotherapeut seinem Patienten begleitend empfohlen hat, bei diesem sodann Muskelschmerzen auftreten können.
Solch ein Muskelkater bedeutet jedoch nicht gleich, dass der Therapeut etwas „falsch gemacht“ hat oder gar ein rechtlich sanktionierbarer Behandlungsfehler vorliegt. Gleichwohl lohnt eine genauere Betrachtung solcher Sachverhalte, und wie so oft hilft hierbei zunächst ein Blick in das Gesetz.
Was sagt das Gesetz?
§ 630h BGB nimmt ausführlich zur Haftung des Therapeuten bei Behandlungs- und Aufklärungsfehlern Stellung. Dabei fällt zunächst auf, dass grundsätzlich ein Patient den Behandlungsfehler nachweisen muss und ebenso, dass durch die vorangegangene Behandlung ein Schaden entstanden sein muss. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass schon in einer fehlerhaften oder unzureichenden Aufklärung des Patienten ein Behandlungsfehler liegen kann. Und: Der Gesetzgeber arbeitet an mehreren Stellen mit „gesetzlichen Vermutungen“, die – sollten die gesetzlichen Bestimmungen nicht strikt eingehalten werden – alle zulasten des behandelnden Therapeuten gehen. Daher werden nachfolgend die einzelnen Regelungsinhalte des § 630h BGB genauer dargelegt.
Allgemeines Behandlungsrisiko
Gemäß § 630h Abs.1 BGB wird ein Behandlungsfehler des Therapeuten vermutet, wenn sich ein allgemeines Behandlungsrisiko verwirklicht hat, welches für den Behandelnden voll beherrschbar war und das zur Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Patienten geführt hat. Diese gesetzliche Vermutung setzt also voraus, dass das Risiko einer Falschbehandlung vom Therapeuten erkannt wurde und abwendbar war. Zudem muss diese gleichwohl durchgeführte Behandlung dann kausal zu einer entsprechenden Körperverletzung oder Gesundheitsbeeinträchtigung geführt haben.
Nachweis von Aufklärung und Einwilligung
Gemäß § 630h Abs. 2 BGB hat der Therapeut zu beweisen, dass er den Patienten vor der Behandlung entsprechend den Anforderungen des § 630e BGB aufgeklärt und zudem eine Einwilligung gemäß § 630d BGB eingeholt hat. Durch die Auferlegung dieser Beweislast zeigt der Gesetzgeber, wie elementar eine vorherige Aufklärung sowie die Einholung einer entsprechenden Einwilligung in die bevorstehende Behandlung für den Therapeuten sind, um später Haftungsrisiken zu vermeiden. Zudem eröffnet § 630h Abs. 2 BGB noch eine Hintertür für den behandelnden Therapeuten, denn falls die Aufklärung nicht den Anforderungen des § 630e BGB genügen sollte, kann der behandelnde Therapeut sich darauf berufen, dass der Patient auch im Fall einer ordnungsgemäßen Aufklärung in die Maßnahme eingewilligt hätte.
Nachweis von Aufzeichnung in Patientenakte und deren Aufbewahrung
In § 630h Abs. 3 BGB wird eine Nachweispflicht des Therapeuten geregelt, welche bei Nichtbeachtung eine entscheidende Rechtsfolge nach sich zieht: Hat der Therapeut eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen § 630f Abs. 1 oder 2 BGB nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f Abs. 3 BGB nicht 10 Jahre aufbewahrt, wird vom Gesetzgeber vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat.

Behandelt ein Therapeut ohne die nötige Qualifikation, geht das Gesetz davon aus, dass dies den Schaden beim Patienten verursacht hat (Bildquelle: © YURII MASLAK – stock.adobe.com)
Dies bedeutet: Selbst wenn der Therapeut eine Behandlung durchgeführt haben sollte, greift – für den Fall, dass er sie nicht dokumentiert hat – wiederum eine gesetzliche Vermutung, dass diese Behandlung de facto nicht stattgefunden hat. Gleiches gilt bei einer Missachtung der Aufbewahrung von Patientenakten. Als Konsequenz in der Praxis kann dies für jeden Therapeuten nur bedeuten, streng auf eine Einhaltung seiner Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zu achten, will er bei Nichtbeachtung im Streitfall nicht haftungsrechtliche Nachteile erleiden.
Befähigung zur Behandlung
Auch § 630h Abs. 4 BGB schreibt eine gesetzliche Vermutung im Zusammenhang mit Behandlungsfehlern fest: War der Physiotherapeut für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den Eintritt der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ursächlich war. Diese Vermutung des Gesetzgebers ist wohl nachvollziehbar. Es soll niemand ohne entsprechende berufliche Aus- oder Fortbildung (zum Physiotherapeuten oder zum sektoralen Heilpraktiker Physiotherapie) Patienten behandeln. Führt jemand gleichwohl ohne eine solche Befähigung Behandlungen durch, wird bei danach beim Patienten auftretenden Körper- oder Gesundheitsschäden davon ausgegangen, dass diese Schäden auf die mangelnde Aus- oder Fortbildung des Behandelnden zurückzuführen sind.
Grobe Behandlungsfehler
Auch § 630h Abs. 5 BGB schreibt eine maßgebliche Haftungsvermutung zulasten des behandelnden Therapeuten fest. Für den Fall, dass ein grober Behandlungsfehler vorliegt, welcher grundsätzlich geeignet ist, eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit der tatsächlich eingetretenen Art herbeizuführen, geht der Gesetzgeber davon aus, dass der Behandlungsfehler für diese Verletzung ursächlich war. Dies gilt auch dann, wenn es der Behandelnde unterlassen hat, einen medizinisch gebotenen Befund rechtzeitig zu erheben oder zu sichern, soweit der Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erbracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre.

Die Beweislast liegt beim Patienten: Er muss sowohl den Behandlungsfehler als auch den daraus resultierenden Schaden nachweisen (Bildquelle: © YURII MASLAK – stock.adobe.com)
Für diese Haftungsvermutung muss demnach ein grober Behandlungsfehler vorliegen. Von einem solchen ist nach höchstrichterlicher Rechtsprechung auszugehen, wenn der Behandelnde „eindeutig gegen bewährte (ärztliche) Behandlungsregeln oder gesicherte medizinische Erkenntnisse verstoßen und einen Fehler begangen hat, der aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich erscheint, weil er einem Arzt schlechterdings nicht unterlaufen darf“ (siehe BGH, Urteil vom 19.06.2001, BGH, Urteil vom 24.05.2022 sowie BGH, Urteil vom 26.06.2018).
Gilt das nur für Ärzte?
Hierbei muss klargestellt werden: Auch wenn die Formulierungen im § 630h Abs. 5 BGB sowie die dazugehörige Rechtsprechung formal von ärztlichen Behandlungsfehlern sprechen, so sind diese auch für Behandlungsfehler von Physiotherapeuten als einschlägig anzusehen. Ebenso sollte im Blick behalten werden, dass auch mehrere für sich genommen nicht besonders schwerwiegende Fehler zusammengenommen als grob fehlerhaftes Verhalten des Behandlers gewertet werden können.
Achtung: Beweislastumkehr!
Rechtlich ist hierzu anzumerken: Die Beweislast für das Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers liegt grundsätzlich beim Patienten. Liegt allerdings – oft erst nach tatrichterlicher Beurteilung eines entscheidenden Gerichts – ein grober Behandlungsfehler vor, führt dies nach § 630h Abs. 5 BGB zu einer sogenannten Beweislastumkehr. Dies bedeutet, dass in einem solchen Fall dann der behandelnde Physiotherapeut beweisen muss, dass der grobe Behandlungsfehler gleichwohl nicht kausal für die beim Patienten eingetretenen Körper- und Gesundheitsschäden war.
Was bedeutet dies für die Praxis?
Nachträgliche Beschwerden von dem einen oder anderen Patienten werden sich nicht vermeiden lassen. Beim Umgang mit solchen Beschwerden sollte der Physiotherapeut grundsätzlich zwei Aspekte im Blick behalten: Zum einen ist grundsätzlich der Patient für die Darlegung einer Ursächlichkeit zwischen der therapeutischen Behandlung und seinen Beschwerden beweisbelastet. Hierbei müsste ein enger zeitlicher sowie sachlicher Kausalzusammenhang nachgewiesen werden. Ist die Behandlung schon 6 Wochen her, dürfte dieser Beweis ebenso schwer gelingen wie bei späteren Beschwerden im kleinen rechten Zeh, wenn zuvor nur ein Impingement-Syndrom der linken Schulter behandelt wurde. Zum anderen zeigt der eben erfolgte Blick in die Regelungen des § 630h BGB, wie elementar die vollumfängliche und genaue Einhaltung der Aufklärungs-, Einwilligungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten des behandelnden Physiotherapeuten für jegliche Haftungssituationen sein kann.
Vor allem Erfolgsversprechen vermeiden!
Zudem muss noch auf einen maßgeblichen Punkt im Rahmen der Kommunikation zwischen Therapeut und Patienten hingewiesen werden. Zu keinem Zeitpunkt – weder vor dem Vertragsabschluss noch während der Behandlung – sollten dem Patienten vom behandelnden Therapeuten falsche Versprechungen gemacht werden, insbesondere dürfen keine Erfolgsversprechen gegeben werden. Hierfür besteht auch rechtlich kein Anlass, da es sich bei dem Behandlungsvertrag um einen Dienstvertrag handelt, bei dem kein Erfolg, sondern nur die fachgemäße Abgabe der vertraglich vereinbarten Leistung geschuldet wird. Abschließend lässt sich daher sagen: Je sorgfältiger der behandelnde Therapeut im Vorfeld seinen Verpflichtungen nachkommt und diese dokumentiert, umso besser sichert er sich für spätere Streitfälle ab.
Und umso gelassener kann dann eventuellen Beschwerden oder behaupteten Vorwürfen einer Fehlbehandlung begegnet werden. Letztendlich gilt aber auch hier der Rat: Bei anhaltender Kommunikation mit einem Patienten mit dem Inhalt konstant und ernsthaft vorgetragener Vorwürfe, die auf angebliche Behandlungsfehler des Physiotherapeuten gestützt werden, sollte eher früher als später eine rechtliche Beratung und Unterstützung hinzugezogen werden.
Bildquelle Header: © YURII MASLAK – stock.adobe.com