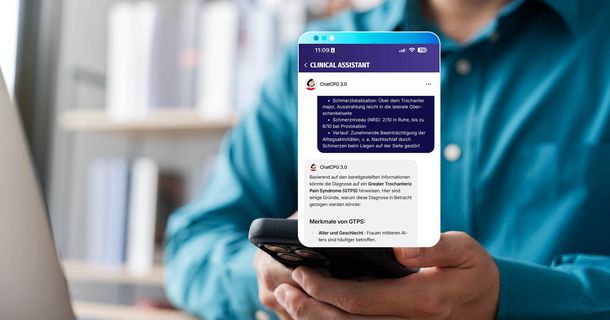Hier kann KI die therapeutische Arbeit schon heute unterstützen:
- Diagnosen
- Dokumentation und Berichte
- Strategische Planung
- Rezeptprüfung
- Termin- und Ressourcenplanung
- Abrechnung
- App-Programmierung
85,5 % ist die Zahl, an der sich menschliche Mediziner bei der Diagnosestellung von jetzt an orientieren müssen und von der sie aktuell noch sehr weit weg sind. Anhand von komplexen und medizinisch herausfordernden Fällen sollte herausgefunden werden, wer die besseren Diagnosen stellt: der Mensch oder die KI.
Als Grundlage dienten Fälle, die im New England Journal of Medicine (NEJM) publiziert worden waren und für deren korrekte Diagnose häufig mehrere Fachspezialisten und viele Tests benötigt werden. Die erfahrenen menschlichen Ärzte aus den USA und Großbritannien schafften bei ihrer Diagnosestellung gerade einmal 19,9 % Genauigkeit.
Und nicht nur die Trefferquote der KI ist deutlich höher, sondern auch ihre Effizienz. Sie kam mit weniger Tests als ihre menschlichen Gegenüber auf die richtige Lösung und konnte dadurch Kosten sparen.
Fünf digitale Ärzte, die sich gegenseitig unterstützen
Möglich wurde das durch Microsofts MAI Diagnostic Orchestrator, kurz MAI-DxO, bei dem fünf KI-Agenten zusammenarbeiten, um die optimale Lösung hinsichtlich der Diagnose, aber auch der Kosten für die medizinische Behandlung zu finden.
Vorstellen kann man sich das wie ein Fünfergespann aus Ärzten, die zusammenarbeiten und dabei jeder eine spezifische Aufgabe übernimmt. So erstellt „Dr. Hypothesis“ eine Liste möglicher Diagnosen, für die „Dr. Test-Chooser“ die notwendigen Tests ermittelt. Zur Vermeidung kognitiver Verzerrungen und zu schnell getroffener Diagnosen überprüft „Dr. Challenger“ alles noch einmal genau.
Die Kosten werden von „Dr. Stewardship“ überwacht und die Qualität von „Dr. Checklist“ gesichert. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht zu früh eine falsche Diagnose gestellt wird. So konnte das Modell z. B. vermeiden, dass fälschlicherweise eine Antibiotika-Toxizität diagnostiziert wurde, obwohl der Patient einfach nur Desinfektionsmittel für die Hände geschluckt hatte.
 Schon jetzt gibt es KI-Assistenten, die prüfen, ob Patienten ihre “Hausaufgaben” gemacht haben und dabei unterstützten, die Übungen zu Hause korrekt auszuführen (Bildquelle: © Meeko Media – stock.adobe.com)
Schon jetzt gibt es KI-Assistenten, die prüfen, ob Patienten ihre “Hausaufgaben” gemacht haben und dabei unterstützten, die Übungen zu Hause korrekt auszuführen (Bildquelle: © Meeko Media – stock.adobe.com)
Natürlich unterliegt diese Untersuchung starken Einschränkungen. So wurde die KI konkret an 304 spezifischen Fällen aus dem NEJM trainiert, während die Mediziner weder auf Fachliteratur noch Kollegen zurückgreifen konnten. MAI-DxO gibt aber schon einmal einen Einblick, was zukünftige KI-Systeme leisten könnten, und dass sie einen Beitrag zur Senkung der enorm hohen Kosten im Gesundheitssystem leisten können.
Auch interessant: Hat sich KI schon in der Physiotherapie etabliert? Experten antworten!
Die Experten hinter der Microsoft-KI gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz in 5 bis 10 Jahren beinahe fehlerfreie Diagnosen stellen könne. Träfe diese Prognose ein, würde sich die medizinische und therapeutische Welt tiefgreifend verändern. Ärzte und auch Physiotherapeuten können auf treffende Diagnosen zurückgreifen und ihre Patienten dadurch passender behandeln.
KI ist weiter verbreitet, als man denkt
Daneben gibt es weitere beachtenswerte KI-Systeme, die schon jetzt eine umfassende Unterstützung liefern können. So erkennt die KI vom koreanischen Unternehmen Mediwhale mithilfe eines Scans der Netzhaut Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen, aber auch Bluthochdruck und Sarkopenie.
Aber auch für die Therapie selbst gibt es vielversprechende Ansätze. So unterstützt der Roboter ARI des „UK National Robotarium“ Patienten bei ihren Übungen in der Reha durch Anweisungen, Korrekturen und Motivation. Das entlastet nicht nur die Therapeuten, sondern soll gleichzeitig dazu führen, dass Patienten ihr Training weiterführen, sei es nun zu Hause oder in einer Trainingseinrichtung.
Damit Patienten ihre „Hausaufgaben“ vom Therapeuten zu Hause auch wirklich durchführen, wurde die KI Sword Health entwickelt. Nach dem Onboarding des Patienten wird ein individuelles Programm für ihn gestaltet, bei dem er vom KI-Assistenten begleitet wird. Dieser überprüft die ausgeführten Bewegungen, gibt Feedback und hilft dem Therapeuten, das Programm an die Bedürfnisse des Patienten anzupassen.
Durch ähnliche Tools wie Flok oder Physio-IAssist differenziert sich der Markt und bietet durchaus spannende Möglichkeiten. Auch hier entwickelt sich der Markt rasant voran und bietet in Zukunft sowohl Patienten als auch Therapeuten weitere Möglichkeiten.
Denkbar sind z. B. umfangreiche Chatbots, die sehr konkrete und genaue Antworten auf die Fragen von Patienten und Physiotherapeuten geben, oder Wearables in Schmuck, die in Echtzeit Bewegungen analysieren und Verbesserungen vorschlagen, bis hin zu Interfaces, die die Interaktion für Menschen mit KI weniger unintuitiv machen.
Auf der anderen Seite stehen den technischen Möglichkeiten große Fragezeichen hinsichtlich Datenschutz und der Akzeptanz künstlicher Systeme gegenüber, insbesondere bei älteren Menschen. Aber auch bei der Integration in die Physiopraxis gibt es große Herausforderungen zu überwinden. Dafür müssen in den nächsten Jahren Lösungen gefunden werden.
Einsatz im Praxismanagement
Kommen wir aber nun zu Anwendungsgebieten von KI, die bereits jetzt möglich sind. Im Vergleich zu den medizinischen Diagnosen von MAI-DxO und Co. wirken die Anwendungsfelder im Therapiebereich weniger öffentlichkeitswirksam, können den Alltag in der Physiotherapie aber deutlich erleichtern. Und häufig werden sie übersehen. KI kann nämlich nicht nur als persönlicher Assistent dienen, sondern auch Abläufe, Prozesse und die Dokumentation optimieren sowie die Kommunikation mit den Patienten vereinfachen.
Starten wir einfach mal mit der Dokumentation. Einer KI reichen Stichpunkte aus, um daraus umfassende Dokumente und sogar Berichte zu erstellen. Auch wenn das schon eine Erleichterung für die Therapeuten ist, geht es sogar noch komfortabler. Und zwar mit Sprachaufzeichnung – am Rechner oder Handy. Die KI erkennt alle für die Doku relevanten Inhalte, strukturiert diese und erstellt daraus einen umfangreichen Bericht. Dieser kann vom Therapeuten, wenn nötig, angepasst werden. Als Unterstützung bieten manche Tools sogar intelligente Vorschläge für den jeweiligen Befund.
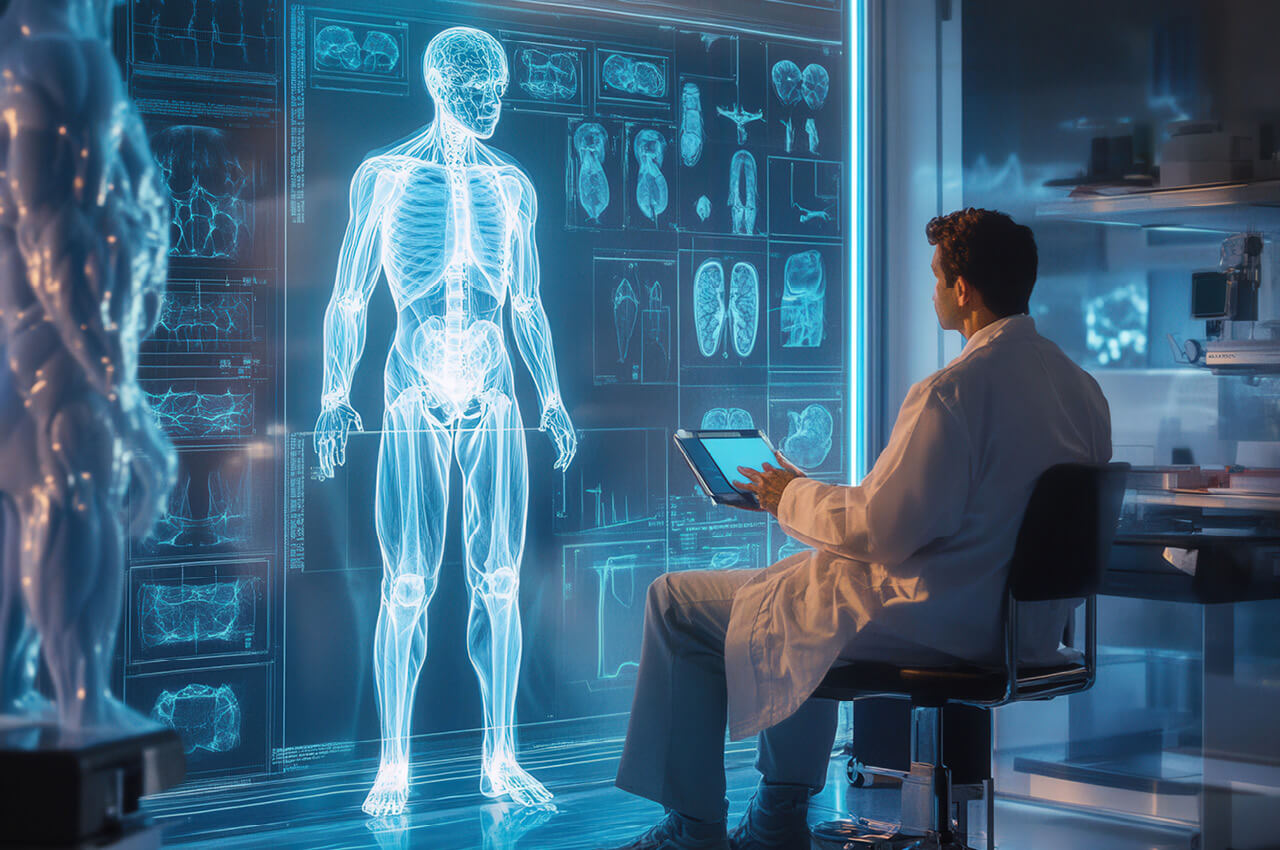 Mit KI-Agenten wie MAI-DxO können Ärzte und auch Physiotherapeuten auf treffendere Diagnosen zurückgreifen und ihre Patienten dadurch passender behandeln (Bildquelle: © Olha – stock.adobe.com)
Mit KI-Agenten wie MAI-DxO können Ärzte und auch Physiotherapeuten auf treffendere Diagnosen zurückgreifen und ihre Patienten dadurch passender behandeln (Bildquelle: © Olha – stock.adobe.com)
Aber auch bei der Termin- und Ressourcenplanung kann KI neue Impulse geben, wie z. B. bei der Senkung der No-Show-Quote, also bei Patienten, die ihren Termin ohne Absage verstreichen lassen.
Entwickelt wurde das System für ein Krankenhaus im Mittleren Osten, das eine hohe No-Show-Quote hatte, die es selbst durch Textnachrichten, E-Mails und Anrufe nicht abgesenkt bekam. Auch der Weg, die Termine zu überbuchen, funktionierte an manchen Tagen und an anderen nicht. Daher wurde ein System entwickelt, das auf Basis der Patientenhistorie sowie weiterer individueller Merkmale Muster erkennt. Dabei berücksichtigt es wiederkehrende Faktoren, wie z. B. den Monat, den Wochentag und die Uhrzeit des Termins, ebenso wie das Zeitintervall zwischen Buchung und Behandlung sowie die Entfernung zur Klinik und den Zugang zu Verkehrsmitteln.
Erhält ein Patient den Marker mit einer No-Show-Quote von 70 %, wird er angerufen, um ein Wahrnehmen des Termins wieder wahrscheinlicher zu machen. Das reduziert Terminausfälle, macht Therapeuten zufriedener und ermöglicht die Versorgung weiterer Patienten. Durch den Einsatz von Chatbots können Patientenanfragen automatisiert beantwortet und entsprechende Termine geplant werden.
Ein Thema, das immer wieder zu Herausforderungen im täglichen Arbeiten führt, sind die Rezepte. Mittlerweile können KI-Systeme Rezepte und Abrechnungen auf Fehler und Probleme untersuchen, was eine reibungslose Abrechnung wahrscheinlicher macht und mannigfaltige Diskussionen mit Kassen und Ärzten vermeidet. Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, kann sich eine Kosten-Nutzen-Analyse generieren lassen, um zu prüfen, welche Maßnahmen sich rechnen und wie die Praxis wirtschaftlich effizienter strukturiert werden kann.
Die Königsklasse ist es dann, sich einen eigenen KI-Assistenten erstellen lassen, der den Praxisinhaber als strategischen Berater unterstützen kann, wenn es z. B. um die Frage geht, ob ein weiterer Standort eröffnet werden soll. Dazu sollte man erst einmal in sich gehen und überlegen, welche Aufgaben der Assistent übernehmen soll, und ihn dann entsprechend programmieren. Zum Testen reicht es, eine bereits vorhandene Vorlage leicht anzupassen. Für eine komplette Individualität sollte der Assistent von Grund auf programmiert werden.
Ähnlich komplex ist das Programmieren einer App. Wer z. B. spezielle Kennzahlen aus der Praxissoftware oder die Auslastung der Therapieräume schnell und einfach nachvollziehen möchte, kann sich von einer KI eine App, die genau diese Parameter übersichtlich darstellt, programmieren lassen.
Fazit
Es ist ganz wichtig festzuhalten, dass KI-Systeme sowohl Therapeuten als auch den Praxisinhaber in ihrer Arbeit auf unterschiedliche Weise unterstützen können. Sie können eine bessere Datengrundlage für Entscheidungen schaffen, Prozesse automatisieren und effizienter gestalten sowie Menschen Zugang zu Physiotherapie verschaffen, die schlechten oder gar keinen Zugang zu Therapeuten haben.
In den nächsten Jahren werden sich diese KI-Systeme sicherlich weiterentwickeln und neue Möglichkeiten erschließen. Der Einsatz digitaler Unterstützung mag anfangs ungewohnt wirken, doch die Potenziale sind erheblich. Es lohnt sich, künstlicher Intelligenz offen zu begegnen, neue Ansätze zu erproben und eigene Erfahrungen mit dieser zukunftsweisenden Technologie zu sammeln.
Bildquelle Header: © siraphol – stock.adobe.com