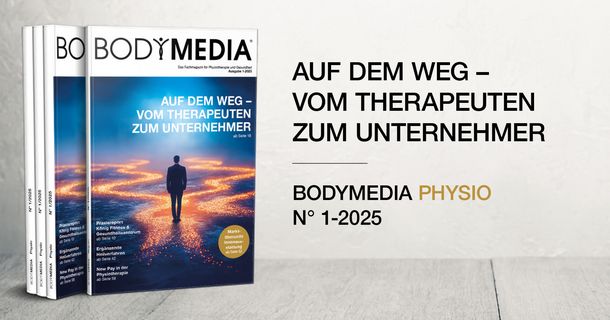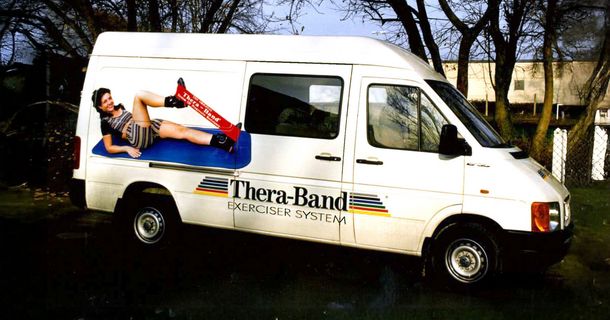Physio, Ergo, Logo – für viele ein offensichtlicher therapeutischer Dreiklang. Daher vereint eine wachsende Zahl an Praxen diese drei Professionen unter einem Dach. Während die Physiotherapie große Schnittmengen mit der Ergotherapie aufweist (siehe Seite 42), sind die Überschneidungen mit der Logopädie etwas geringer, aber nicht unwichtiger. Schauen wir uns einmal an, welche Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit gegeben sein müssen.
Überschaubare Anforderungen an Equipment und Räume
Für Inhaber von Physiotherapiepraxen ist es recht einfach, die räumlichen Voraussetzungen für die Logopädie zu schaffen. Ein Raum mit mind. 20 m² reicht bereits aus. Arbeiten mehr logopädische Fachkräfte in der Praxis, ist für jeden ein weiterer Raum mit 12 m² bereitzustellen. Es sei denn, die Arbeitszeiten der Therapeuten überschneiden sich nicht. Die Räume dürfenkeine Durchgangsräume sein und müssen belüftbar, beheizt und ausreichend beleuchtet sein. Damit sich alle wohlfühlen, ist zusätzlich eine Deckenhöhe von 2,40 m erforderlich.
Zusätzlich muss den Logopäden unterschiedliches Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Das sind Diagnostik- und Therapiematerial sowie Hilfsmittel für alle Störungsbilder, technische Geräte zur Aufnahme und Wiedergabe und Aufbewahrungsmöglichkeiten für Patientenakten und Praxisunterlagen, die den Datenschutzanforderungen entsprechen.
Auch interessant: Ergotherapie als perfekte Ergänzung für die Physiopraxis
Hinzu kommen ein Tasteninstrument sowie ein Computer/Tablet mit spezifischer Software für den therapeutischen Einsatz. Die Logopädie kann also problemlos in die bestehende Praxis integriert werden, denn unterschiedliche Heilmittelbereiche gelten nicht als anderes Gewerbe und dürfen am selben Standort gegründet werden. Die vorhandenen Behandlungsräume müssen aber für den jeweiligen Fachberuf vorbehalten sein. Man kann also nicht einfach schnell eine Liege in den Raum der Logopädie schieben, um Kapazitäten für die Physiotherapie zu schaffen. Alle weiteren Räume wie der Empfang, Büros, der Pausenraum/ Küche und Sanitäranlagen können gemeinsam genutzt werden.
Viele Patienten, wenig Logopäden
Die räumliche Gestaltung stellt daher keine allzu große Herausforderung dar. Nun müssen die Behandlungsräume aber mit Leben gefüllt werden. Von Patientenseite her ist das kein Problem. Der Deutsche Bundesverband für Logopädie e. V. (dbl) berichtete bereits 2021 von Wartezeiten für Patienten zwischen vier und sechs Monaten. Der klare Engpass liegt, wie auch in Physio- und Ergotherapie, auf der Therapeutenseite. Im Schnitt dauert es für Praxisinhaber 146 Tage, um eine ausgeschriebene Logopäden-Stelle zu besetzen, und die Arbeitssuchenden-Stellen-Relation ist mit 0,9 eine der niedrigsten in ganz Deutschland. Dafür ist die Abwanderungsquote aus dem Beruf mit 16,8 % recht hoch.
Innovative Berufsausbildung für bessere interprofessionelle Zusammenarbeit
Damit dürfte es selbst für Unternehmer, die ein gutes Employer Branding haben, angesehen sind und z. B. in der Physiotherapie keine Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden, eine Herausforderung werden, logopädische Fachkräfte zu finden. Ist das geschafft, geht es darum, dass die Logopäden ihre Arbeit bestmöglich machen können, aber auch um eine sinnhafte Zusammenarbeit zwischen Logopädie und Physiotherapie.
Und hier muss sich der Praxisinhaber nun die Frage stellen, wie interdisziplinär beide Fachrichtungen zusammenarbeiten sollen. Denn die Schnittmenge beider Fachrichtungen sind vor allem neurologische Patienten. Werden in der Physiotherapiepraxis jedoch vorrangig orthopädische Patienten behandelt, verringert sich die Schnittmenge und damit das Potenzial, Patienten ganzheitlich zu betreuen. Gehen wir aber einmal davon aus, dass das gegeben ist. Dann sollten beide Professionen wissen, was ihre eigenen Stärken und Kompetenzen sind, sowie auch die des jeweils anderen Fachberufs kennen. Dafür gibt es in den Ausbildungen allerdings häufig zu wenig Raum.

Die räumliche Umsetzung ist bei einer bestehenden Physio-Praxis recht einfach und auch in fachlicher Hinsicht ergänzen sich die beiden Professionen bei ausgewählten Patientengruppen (Bildquelle: © Prostock-studio – stock.adobe.com)
Eine Hochschule, die für die stärkere Verzahnung der Fachberufe steht, ist der Gesundheitscampus Göttingen, der im Rahmen einer Kooperation der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG), unterschiedliche Gesundheitsberufe gemeinsam ausbildet.
Das Modell am Gesundheitscampus Göttingen macht es möglich, Studium und Ausbildung im jeweiligen Fachbereich eng miteinander zu verzahnen, und schafft so eine interprofessionelle Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe. Die Studierenden belegen allgemeinere Module wie z. B. wissenschaftliches Arbeiten gemeinsam. Für ihre fachspezifischen Module sind die einzelnen Berufsgruppen zwar unter sich, erhalten jedoch beispielsweise im Rahmen der interprofessionellen Woche die Möglichkeit, gemeinsam an einem Patientenfall mit Simulationspersonen zu arbeiten. In diesen interprofessionellen Lerneinheiten erstellen die angehenden Physiotherapeuten, Logopäden, Pflegekräfte und Sozialarbeiter eine fachspezifische Anamnese und entwickeln daraus den bestmöglichen Therapieplan.
Worauf es wirklich ankommt
So erfahren die Studierenden, worauf es bei der Anamnese und Behandlung der jeweils anderen Professionen ankommt. Der Behandlungsplan wird dann an den Simulationspatienten kommuniziert, woraufhin dieser Feedback an die Studierenden gibt. So lernen die Studierenden, worauf es fachlich ankommt, aber und für die spätere Arbeit auch sehr wichtig, wie sie mit den Patienten und untereinander kommunizieren.
„Für den Therapieerfolg ist die räumliche Nähe der Fachkräfte zueinander entscheidend“, weiß Prof. Dr. Juliane Leinweber. Sie ist Diplom-Logopädin und vertritt das Fach der Therapiewissenschaften an der HAWK am Gesundheitscampus Göttingen. Daher nimmt sie die gemeinsame Integration von Logopädie und Physiotherapie als sehr sinnvoll wahr, sieht aber auch Herausforderungen für die Praxisbetreiber. „Hürden dabei sind ungünstige zumeist rechtliche (Abrechnungsmodalitäten) und organisatorische Rahmenbedingungen, die es Therapeuten erschweren, interprofessionell bestmöglich zusammenzuarbeiten.“ Die im Studium simulierten Bedingungen sind also nicht unbedingt der Alltag in jeder Praxis.
Aber auch in Praxen kann interprofessionelle Zusammenarbeit im Team positiv beeinflusst werden – sowohl auf fachlicher als auch informeller Ebene. Juliane Leinweber empfiehlt Praxisinhabern, eine räumliche Nähe der Teammitglieder, gemeinsame Aus-und Weiterbildungen, klare Prozesse und Strukturen sowie formelle Termine für einen regelmäßigen Austausch (z.B. Fallkonferenzen) zu etablieren. Wenn Praxisinhaber eine interprofessionelle Haltung vorleben, wirkt sich das auch positiv auf die interprofessionelle Zusammenarbeit im Team aus.
Ein absolut lohnendes Konzept
Logopädie und Physiotherapie in einer Praxis zu vereinen, ist ein absolut lohnendes Konzept. Die räumliche Umsetzung ist bei einer bestehenden Praxis einfach und auch in fachlicher Hinsicht ergänzen sich die beiden Professionen bei ausgewählten Patientengruppen. Die größte Herausforderung ist sicherlich das Rekrutieren geeigneten Fachpersonals. Wer also über die Integration einer Logopädie in seine bestehende Physiopraxis nachdenkt, sollte bereits in Kontakt mit einem Logopäden stehen, der für ihn arbeiten möchte. Andernfalls könnte die Wartezeit, jemanden zu finden, trotz hoher Rekrutierungsanstrengungen etwas lang werden.
Bildquelle Header: © Prostock-studio – stock.adobe.com