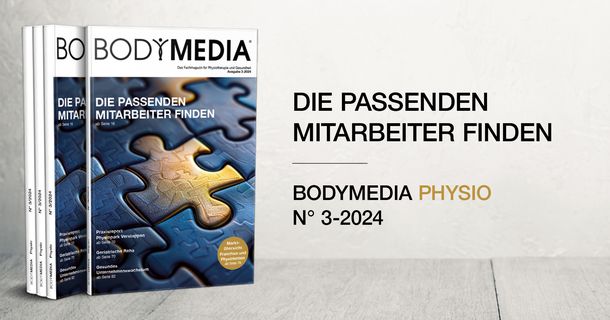Jede zweite Person in Deutschland ist älter als 45, jede fünfte hat sogar schon die 66 überschritten. Die geburtenstarken Babyboomer gehen langsam in den Ruhestand und hinterlassen große Lücken in der Arbeitswelt. Das geht natürlich auch am Gesundheitswesen nicht vorbei. Sei es nun bei Hausärzten, Pflegepersonal oder in der Physiotherapie.
Das stellt das Gesundheitssystem und die damit verbundene Versorgung der Patienten vor große Herausforderungen. Das Gute daran: Unter diesem Druck kommt jetzt endlich etwas Bewegung in das Thema Prävention. Programme wie z. B. T-RENA sind Maßnahmen, die Menschen zeigen, dass sie sich nicht immer auf die Funktionstüchtigkeit ihres Körpers verlassen können und dass sie sich unabhängig von Ärzten um ihre Gesundheit kümmern müssen.

Das Ziel einer geriatrischen Reha ist es, die Selbstständigkeit eines Patienten im Alltag wiederherzustellen und zu sichern (Bildquelle: © Photographee.eu – stock.adobe.com)
Im Hinblick auf die steigende Pflegebedürftigkeit der Bevölkerung bei gleichzeitig schlechter werdender Versorgung wird die Notwendigkeit von Prävention immer dringlicher. Insbesondere neurodegenerative Erkrankungen wie Demenz oder Parkinson, Schlaganfälle oder Sturzerkrankungen stehen hier im Vordergrund, da sie nach akuten Ereignissen häufig mit Pflegebedürftigkeit verbunden sind. In diesem Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass eine geriatrische Reha helfen kann, die Pflegebedürftigkeit zu verzögern.
Gleichzeitig zeigt sich auf der politischen Seite ein sehr inkohärentes Bild. Einerseits wurden von politischer Seite mit Innovationsfonds geförderte G-BA-Projekte für die Rehabilitation von Geriatrie-Patienten ins Leben gerufen, andererseits wird die rehabilitative Versorgung von Hochbetagten nicht einheitlich geregelt, sondern den einzelnen Bundesländern überlassen. Wir möchten nun einmal schauen, wie sich die derzeitige Situation in der geriatrischen Reha darstellt.
Wer erhält überhaupt eine geriatrische Reha?
Ziele einer geriatrischen Reha sind die Wiederherstellung der Selbstständigkeit und die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit. Die aktuelle Evidenzlage zeigt, dass eine geriatrische Reha durchaus den Eintritt in die Pflegebedürftigkeit hinauszögern kann. Trotzdem wird diese Form der Reha häufig nicht proaktiv von Ärzten empfohlen, sondern durch ein Event wie z. B. einen Sturz ausgelöst. Daher werden vor allem Menschen aufgenommen, deren Alltagsfunktion durch eine OP oder schwere Krankheit eingeschränkt ist.
Durchschnittlich sind Patienten in einer geriatrischen Reha 80 Jahre alt. Medizinische Indikationen, die eine Reha erforderlich machen, sind neben den oben genannten neurodegenerativen Erkrankungen u. a. Folgezustand nach Ersatz von Knie-, Schulter- und Hüftgelenken, Arthrose, chron. Schmerzen, Gangstörungen, Schwindel und Altersdepression.
Neben der medizinischen Indikation sind weitere Voraussetzungen für die geriatrische Reha ein höheres Alter, also 70 Jahre oder älter, und die Rehabilitationsfähigkeit. Das kennt man auch aus der Tätigkeit in der Physiopraxis, wo Patienten häufig für eine aktive Therapie vorbereitet werden müssen. Die Hürden für die Teilnahme an einer geriatrischen Reha sind also recht gering.
Trotzdem gibt es auch Gründe, die eine Teilnahme verhindern können. Dies liegt dann vor, wenn es bspw. nur um die Pflege des Patienten geht, eine Behandlung im Krankenhaus bei einer akuten Erkrankung oder eine krankheitsbezogene Reha sinnvoller wäre. Ist die Entscheidung für die geriatrische Reha gefallen, kommen drei mögliche Umsetzungsformen in Betracht: die ambulante Reha, die stationäre Reha oder die mobile Reha.
Auch interessant: T-RENA, RV-Fit, Rehasport und Funktionstraining in der Praxis
Ist die Versorgung im häuslichen Umfeld gewährleistet und die Rehaklinik nicht weiter als 45 Minuten Fahrweg von zu Hause entfernt, ist die ambulante Reha eine gute Lösung für die Patienten, da sie den jeweiligen Abend und die Wochenenden in ihrem gewohnten Umfeld verbringen können. Während diese Form für viele jüngere Patienten sicherlich umsetzbar ist, findet die geriatrische Reha meist in stationärer Form statt. Vor allem dann, wenn Patienten noch ärztlich überwacht werden müssen oder Pflege von ausgebildetem Personal brauchen.
Auch wenn die Patienten deutliche Einschränkungen aufweisen und die Erkrankungen ambulant nicht adäquat behandelt werden können, wird die stationäre Reha bevorzugt. Ein weiterer Grund für diese Rehaform ist das Herauslösen aus dem gewohnten sozialen Umfeld aufgrund von medizinischen oder psychologischen Gründen.
Eine mobile Reha wird nur dann in Erwägung gezogen, wenn die Gefahr besteht, dass sich der Gesundheitszustand des Patienten verschlechtern könnte. Hier ist der Aufwand durch die Versorgung des Patienten zu Hause deutlich höher. Auch wenn das Herauslösen aus dem Umfeld für die stationäre Reha manchmal sinnvoll sein kann, wirkt sich die Anwesenheit von Angehörigen in der Reha meistens positiv aus.
Daher wird z. B. die Teilnahme der Partner auch von der Krankenkasse übernommen, wenn die Anwesenheit medizinisch als notwendig erachtet wird. Wie viele andere stationäre Rehas auch dauert die geriatrische Reha 3 Wochen, mit der Möglichkeit, sie zu verlängern. Findet sie ambulant statt, sind bis zu 20 Tage möglich.
Am Anfang steht immer eine ärztliche Untersuchung. Nach Abschluss der körperlichen Untersuchung folgt ein geriatrisches Assessment, bei dem Ausfälle und Fähigkeiten des Patienten ermittelt werden. Dazu werden von verschiedenen Professionen unterschiedliche Tests durchgeführt, auf deren Grundlage ein individueller Therapieplan erstellt wird.
Während viele Rehapatienten von Tagen voller Therapie und Programm berichten, werden in der geriatrischen Reha in Abhängigkeit von der Patientenbelastbarkeit zwei bis vier Therapien pro Tag durchgeführt.
Pflege-Report 2020: Aktueller Stand der geriatrischen Reha
Dass eine geriatrische Reha die Pflegebedürftigkeit hinauszögern kann, ist von der Evidenz gedeckt. Daher wollte der Gesetzgeber durch das zweite Pflegestärkungsgesetz den Anteil der Rehabilitationsempfehlungen erhöhen. Das gelang auch – der Wert stieg von 1,1 % auf 2,7 %.
Das heißt aber nicht, dass auch alle Empfehlungen wirklich in die Tat umgesetzt werden. Zwischen 2015 und 2018 wurden nur zwischen 37 % und 49 % der empfohlenen Rehabilitationsmaßnahmen auch angetreten. Gründe dafür reichen von einem unzureichenden Versorgungsangebot bis hin zu Verpflichtungen gegenüber Angehörigen.
Insbesondere die Situation der stationären geriatrischen Reha ist gut untersucht. So zeigen sich für viele unterschiedliche Erkrankungen effektive Wirkungen. Selbst Patienten mit COPD und pAVK profitieren von den Rehamaßnahmen. Bei elektiven OPs wie Knie- oder Hüftgelenksersatz zeigen stationäre und ambulante Rehamaßnahmen eine vergleichbare Wirkung. Aus Kostengründen wäre dann die ambulante Maßnahme zu bevorzugen. Was hingegen recht wenig untersucht ist, sind die Wirkungen von einer stationären geriatrischen Reha mit onkologischen Erkrankungen oder kardiologischen Klappeninterventionen.

Im Schnitt sind Patienten in der geriatrischen Reha 80 Jahre alt (Bildquelle: © zakiroff – stock.adobe.com)
Die hauptsächliche Zielgruppe der geriatrischen Reha sind Patienten, die in den meisten Fällen mit Gehhilfen noch gehfähig sind. Zwar ist der Pflegeaufwand dieser geriatrischen Patienten größtenteils hoch, der Pflegegrad aber relativ gering.
Demnach ist das Ziel der Reha, die Erhöhung des Pflegebedarfs zu verhindern sowie die außerhäusliche Mobilität zu erhöhen. Im Pflege-Report 2020 wird betont, dass die Zufriedenheit der Patienten einer ambulanten geriatrischen Reha sehr hoch ist, die Verbreitung sich allerdings noch zu sehr auf große und mittelgroße Städte beschränkt.
Ein weiterer Unterschied zwischen der stationären und ambulanten geriatrischen Reha liegt in der Intensität der Therapie. Während in der stationären Reha die schon genannten 2–4 Einheiten pro Tag stattfinden, sind es in der ambulanten Reha mehr als fünf Stück.
So schön sich das auch alles anhört, ist der Einfluss der geriatrischen Reha auf die Reduktion der Pflegebedarfe begrenzt, da die Fallzahlen insgesamt sehr gering sind. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Empfehlungen für eine solche Reha aufgrund eines Vorfalls wie z. B. eines Schlaganfalls oder eines Sturzes abgegeben werden.
All diejenigen Menschen, deren Gesundheitszustand sich nach und nach zu Hause verschlechtert, würden von Rehamaßnahmen profitieren, erhalten aber keinen Zugriff darauf. Als Allheilmittel wird dann häufig auf die Physiotherapie zurückgegriffen, die allerdings nicht das ganze Behandlungsspektrum abdecken kann und in ihrer üblich stattfindenden Frequenz zu wenig langfristige Effekte erzielen kann.
Diese Patienten würden von ambulanten Rehamaßnahmen durchaus profitieren, da sie sich zudem häufig nicht in eine stationäre Aufnahme begeben möchten, um z. B. einer nosokomialen Infektion zu entgehen. Um diesen Patienten einen Zugang zu rehabilitativen Maßnahmen zu ermöglichen, wurde 2021 ein Modellprojekt gestartet, das Interventionen auf unterschiedlichen Ebenen durchführt.
PromeTheus-Studie
Das Programm „Prävention für mehr Teilhabe im Alter“ richtet sich an Patienten, die zu Hause leben und sich mit steigender Gebrechlichkeit konfrontiert sehen. Die Intervention besteht aus einer Kernkomponente mit 10 Hausbesuchen durch einen Physiotherapeuten innerhalb von 12 Monaten, fünf zusätzlichen Telefonaten und einem selbstständigen Training dreimal pro Woche.
Hinzu kommen mit der Beratung durch den Sozialen Dienst, einer Ernährungsberatung und einer Hilfsmittelberatung/Basis-Wohnraumberatung die Bedarfskomponenten. Da für geriatrische Patienten soziale Kontakte wichtig sind, werden die ersten beiden Komponenten durch eine Gruppenkomponente wie z. B. die Vermittlung in eine Sportgruppe ergänzt.
Obwohl die Studie offiziell bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein sollte, waren bis zum Ende des Redaktionsschlusses keine Ergebnisse publiziert. Daher wird sich noch zeigen müssen, welche Effekte die Intervention wirklich hat.
Fazit
Was bringt eine Maßnahme, die zwar effektiv ist, aber von zu wenigen Patienten in Anspruch genommen wird? Das ist die große Frage bei der geriatrischen Reha. So hilfreich die Maßnahmen für die Patienten auch sind, kommen sie nicht in ausreichender Menge bei Betroffenen an. Zu sehr wird in Deutschland auf auslösende Events gewartet.
Bildquelle Header: © Generative AI – stock.adobe.com