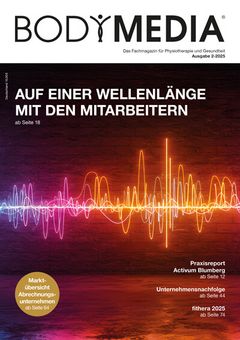Das Wichtigste in Kürze:
- Unterschiedliche Erziehungsstile prägen das Arbeits- und Kommunikationsverhalten der Generationen – von Autorität bis Coaching.
- Generation Z erwartet Wertschätzung, Orientierung und regelmäßiges Feedback – Führungskräfte werden zunehmend zu Coaches.
- Konflikte entstehen oft durch Missverständnisse zwischen hierarchischem Denken und dem Bedürfnis nach Teamkultur und Augenhöhe.
- Klare Regeln, transparente Kommunikation und partizipative Strukturen schaffen Sicherheit und Verbindlichkeit im Team.
- Tools wie Mentoring, Perspektivwechsel-Meetings und ein „Growth Mindset“ fördern Verständnis, Entwicklung und Generationen-übergreifende Zusammenarbeit.
Was haben blaue Punkte und gesellschaftliche Probleme gemeinsam? Wenn sie weniger werden, sucht man sich sie selbst. Das haben Levari et al. (2018) in einer Untersuchung festgestellt. Dasselbe Phänomen wurde unter anderem auch bei bedrohlich wirkenden Gesichtern festgestellt. Probanden in Studien haben neutrale Gesichter als „bedrohlich“ empfunden, weil sie bedrohliche Gesichter finden wollten.
Vor allem in Bezug auf die Generation Z (Jhg. 1995–2010) hört man oft: „Die jungen Leute möchten sich nicht mehr anstrengen“, „Er hat einfach ohne Grund gekündigt“ oder „Meine Ansagen werden nicht umgesetzt“. Es kann individuell am Gegenüber liegen – oder aber: Man sucht den „blue dot“ an der Generation Z. Das muss nicht sein, wenn man sich den Bedürfnissen der Generation Z nähert und diese erfüllt. Häufig jedoch projizieren wir unsere Weltsicht auf den anderen und verletzen unter Umständen dessen Selbstwertgefühl.
Folgendes Zitat kann als Leitlinie dienen: „Kühner, als das Unbekannte zu erforschen, kann es sein, das Bekannte zu bezweifeln.“ (Birkenbihl, 2022) Aber was ist denn das „Bekannte“ für die einzelnen Generationen? Frühkindliche Erfahrungen in der Entwicklung von Beziehungen werden im weiteren Lebensalter als Muster auf ähnliche hierarchische Beziehungsstrukturen geschlechtsunabhängig übertragen. Deshalb lohnt sich ein Blick in die Erziehung der Generationen.
Erziehungsgrundsätze der Generationen
Für die Babyboomer (1950–1965) hieß die Normalität: Autorität. Es gab in der Familie klare Hierarchien, in denen zuerst der Vater, dann die Mutter und dann die Kinder kamen. Mitspracherecht für die Kinder gab es kaum. Entschieden haben die Eltern. Die Kinder hatten zu gehorchen. Das war die Normalität in Schule und Beruf. Zudem lernten die Babyboomer neben der Hierarchie auch, dass Arbeit Vorrang vor allem anderen hat (Stanton, 2017).
Die Generation X (1965–1980) erlebte in der Erziehung zum ersten Mal Mitbestimmung. Trotzdem lag die finale Entscheidung bei den Eltern. Tschernobyl und das Ozonloch haben die GenX auf die Straße gebracht, um ihre Meinung über die Umweltzerstörung kundzutun.
Auch hier verhallten ihre Rufe nach Besserung. Diese Generation, die durch den Pillenknick und die geringere Geburtenzahl sowieso weniger Geschwister hatte, zog sich in den Individualismus zurück (Stanton, 2017, Engelhardt & Engelhardt, 2019). Eigenverantwortung und kritisches Hinterfragen sind das, was die GenX im Arbeitsleben geprägt hat und von anderen erwartet.
Die Babyboomer, die zum großen Teil die Eltern der Generation Y bzw. Millenials (1980–1995) sind, haben ihre Erziehung reflektiert und sich gefragt: „Will ich meine Kinder genauso streng erziehen, wie ich erzogen wurde?“ So hat sich bei den Millennials ein verständnisorientierter Erziehungsstil durchgesetzt (Engelhardt & Engelhardt, 2019). Den Kindern wurde auf Augenhöhe begegnet, Mitspracherecht wurde gewährt und Entscheidungen durften sie auch treffen.

Beim Mentoring geht es um den Aufbau einer persönlichen Beziehung zwischen einem erfahrenen und einem weniger erfahrenen Mitarbeiter. Diese begegnen sich auf Augenhöhe und lernen voneinander (Bildquelle: © Stock 4 You – stock.adobe.com)
Hier fällt das Wort „Wertschätzung“ in der Erziehung zum ersten Mal. Der Einbezug in die Gemeinschaft, die Nestwärme, ist für diese Genertion enorm wichtig. Durch die moderneren Berufsmodelle sind die Mütter und Väter früher ins Arbeitsleben zurückgekehrt. So haben sich die Millennials an stetig wechselnde Beziehungen und Bezugspersonen gewöhnt.
Diese hatten alle unterschiedliche, aber klare Regeln – und das wünscht sich diese Generation auch vom Arbeitgeber. Gepaart mit einer sich immer schneller drehenden Welt sind so der Drang nach Unverbindlichkeit und die Sehnsucht nach Orientierung gewachsen.
Die Eltern der GenZ entstammen vorrangig der Generation X. Der Erziehungsstil war und ist geprägt durch Coaching ihrer Kinder für mehr Erfolg im Berufsleben. 95 %der Gen Z haben einen beratenden Erziehungsstil genossen (Engelhardt & Engelhardt, 2019). Dies fordern die Zler auch von den Führungskräften ein.
Sie fragen sich: „Was soll ich machen, wenn es mir schlecht geht?“, „Wem kann ich vertrauen?“ und „Was kann ich werden?“. Die Vorgesetzten werden somit eher zu Coaches, die mit Anerkennung, Wertschätzung und auf Augenhöhe arbeiten sollen. Wie machen sich diese erlernten Eigenschaften nun konkret im Arbeitsalltag bemerkbar?
Weniger Hierarchien – mehr Sprengstoff?
Vom alten Hierarchiedenken, das noch bis in die Generation X gewirkt hat, ist nicht mehr viel übrig in den jüngeren Generationen. Das sorgt schon ab Beginn der Arbeitsbeziehung für möglichen Sprengstoff.
Konkretes Beispiel: Zwei Gen-Zler stehen auf der Trainingsfläche, quatschen und lachen. Diejenigen mit vorhandenem Hierarchiedenken nähern sich der Gruppe und sagen: „Na, gibt’s nichts zu tun?“ Darauf erwidert die Gruppe: „Ne, ist grade relativ ruhig.“ Das bringt die Führungskraft auf die Palme, wie sich denn die Mitarbeiter zu seinem subtilen Hinweis so äußern können.
Er hat sie in seiner Intention aufgefordert, sich aufzulösen und Aufgaben zu erledigen. Millennials und GenZ sehnen sich aber nach Nestwärme und einer guten Arbeitsatmosphäre mit ihren „besties“. Babyboomer und GenX möchten jedoch in ihrer Führungstätigkeit nicht von oben herab diktieren, sondern versuchen dennoch, eine gute persönliche Beziehung zu ihren Mitarbeitern zu erhalten (Stanton, 2017). Daraus resultiert in diesem Beispiel keine klare Arbeitsanweisung, die jedoch an der Stelle erforderlich ist (Engelhardt & Engelhardt, 2019).
Auch interessant: Was Mitarbeiter von der internen Kommunikation erwarten
Besonders, wenn Mitarbeiter jung, frisch im Unternehmen oder in Ausbildung stehen, ist es wichtig, sich auch selbst zu reflektieren. Häufig wird es diesen Mitarbeitern negativ ausgelegt, wenn sie z. B. offensichtlich „arbeitslos“ am Empfangsbereich stehen. Als erfahrene Führungskraft hat man das Wissen, was kontinuierlich zu erledigen oder zu prüfen ist.
Der erfahrene Blick fehlt bei den jungen Leuten. Sie sind – vor allem in der GenZ – gewohnt, dass man ihnen sagt und zeigt, was zu tun ist. Habe ich das als Führungskraft berücksichtigt? Oder gehe ich davon aus, dass der andere weiß, was ich möchte oder was zu tun ist? Hier hilft nur die direkte Ansprache.
Viele Führungskräfte mögen dabei keine „Mikro-Manager“ sein. Diejenigen, die ständig jede Aufgabe vorgeben und jeden Schritt kontrollieren. Dieses Bestreben ist auch gut, da die Millennials und die GenZ eine hohe Autonomie in ihrem Job besitzen möchten (Stanton, 2017). Wird die Aufgabenerledigung jedoch gar nicht evaluiert und durch die Führungskraft bestätigt, kommt schnell das Gefühl auf, dass die Arbeit nicht wichtig ist und wertgeschätzt wird (Engelhardt & Engelhardt, 2019).
Es droht die zunehmende Vernachlässigung der Aufgaben. Daher lohnt es sich, ein System zu implementieren, das auf kontinuierlichem Feedback und direkter Belohnung beruht. Das kann in Form von Unterschriftenlisten sein, die nach erledigter Aufgabe gepflegt und von der Führungskraft kontrolliert werden.

Unverbindlichkeit, Selbstverwirklichung und Sinnsuche sind wesentliche Eigenschaften der GenZ, mit der Führungskräfte konfrontiert werden (Bildquelle: © Stock 4 You – stock.adobe.com)
Sanktionen bei Nicht-Erledigung oder Pflege der Aufgaben und Liste sind dann ein probates Mittel, wenn es dem Teamzusammenhalt dient. Beispielsweise mit einem kleinen Betrag in die Teamkasse, wenn jemand gegen die Regeln verstößt. Mit ausreichend hoher Kassensumme wird das Team dann z. B. zum Essen, Lasertag oder in den Escape Room eingeladen. Win-win für Effizienz und die Arbeitsatmosphäre. Tipp: Machen Sie die Kontrolle zur Teamaufgabe. Zler möchten keine Einzelkämpfer sein und arbeiten lieber im Team.
Regeln klar festlegen – gerade fürs Smartphone
Welche Regeln im Arbeitsumfeld, in der Kommunikation und in Meetings gelten, muss zwingend im Team besprochen und festgehalten werden. Auch was die Nutzung digitaler Technologie angeht. So berichten Johnson & Anderson (2016) von einem Beispiel, dass Babyboomer es in Meetings häufig als unhöflich ansehen, wenn Millennials oder Gen-Zler das Smartphone nutzen.
Die jedoch nutzen die digitale Technik auch, um relevante Themen zum Meeting zu recherchieren. Stephen Covey hat das „corporate mission statement“ beschrieben, in dem Regeln über Ziel und Zusammenarbeit festgehalten werden und das sichtbar für alle ausgehangen wird. Es muss zwingend gemeinsam besprochen und verabschiedet werden. Als ältere Führungskraft darf man sich auch nicht angegriffen oder herabgesetzt fühlen, wenn GenZ Abläufe und Anweisungen kritisch hinterfragt (Stanton, 2017).
Das sind die jungen Menschen aus der Erziehung und Schule gewohnt. Nehmen Sie das Feedback auf und besprechen Sie die Anregungen konstruktiv. Unverbindlichkeit, Selbstverwirklichung und Sinnsuche sind wesentliche Eigenschaften der GenZ, mit der Sie als Führungskraft konfrontiert werden (Maas, 2019). Die Stärken Ihrer jungen Mitarbeiter herauszufinden und sie vermehrt dort einsetzen, wo es ihnen Spaß macht, ist unheimlich wichtig.
Leidendes Durchhalten ist nicht gerade die Stärke der GenZ. Regelmäßige Feedbackrunden und kurze Mitarbeitergespräche, die mehrmals pro Monat stattfinden, bilden hierfür die Grundlage. „Was kann ich werden?“ – die Frage der GenZ, die sie sich selbst beantworten möchte, bedeutet für Führungskräfte, Perspektiven und Sinnhaftigkeit aufzuzeigen.
Im engen Austausch die Mitarber:innen zu führen und Karrierewege aufzuzeigen, führt zu langfristiger Zufriedenheit, hoher Bindung und ist eine elementare Aufgabe moderner Führungskräfte. Diese drei Tools können direkt umgesetzt werden und haben sich in der Praxis bewährt.
Mentoring einführen: Das Mentoring bildet den Gegensatz zum klassischen Vorgesetzten-Mitarbeiter-Verhältnis (Deluliis & Saylor, 2021). In Mentorenpaaren geht es um den Aufbau einer persönlichen Beziehung zwischen einem erfahrenen und einem weniger erfahrenen Mitarbeiter.
Diese begegnen sich auf Augenhöhe und lernen voneinander. Vor allem, wenn ein größerer Altersunterschied besteht. Mentoring basiert darauf, dass Stärken ausgeprägt werden und nicht auf den Schwächen und Mängeln „rumgebosst“ wird. Aktives Zuhören ist dabei elementar. Schulen Sie auch gerne Ihre Mitarbeiter in „soft skills“, sollten Sie hier Verbesserungsbedarf erkennen. Es kann ein Gamechanger werden.
Mitarbeiter zum Perspektivwechsel anleiten: Häufig sind Menschen der Meinung, ihre eigenen Ansichten und Erfahrungen müssten auch von den jeweiligen Gesprächspartnern automatisch erkannt und angenommen werden. Daher bietet sich ein offener Perspektivaustausch an (Engelhardt & Engelhardt, 2019).
Rufen Sie Ihre Mitarbeiter zu einem Meeting zusammen. Schreiben Sie auf einem Flipchart oder Whiteboard die konkrete Situation auf, die zu Unzufriedenheit geführt hat. Dann lassen Sie nach und nach alle Generationen zur Situation zu Wort kommen. Anschließend folgen Lösungsvorschläge aller Beteiligten.
Zum einen werden sie häufig bemerken, wie wenig Missverständnis herrscht und wie viel Vorurteil besteht. Zum anderen bekommen Sie eine wunderbare Lösung, die alle zufriedenstellt.
„growth mindset“ einführen: Menschen mit einem hoch ausgeprägten „growth mindset“ erreichen deutlich mehr (Deluliis & Saylor, 2021). Das allein mit dem Glauben, dass die Anstrengung sich lohnt und Fähigkeiten sich trainieren sowie verbessern lassen. Hiermit lassen sich sowohl die Millennials als auch die GenZ begeistern.
Die einfachste Methode, hiermit zu starten, ist das Wort „noch“ einzuführen – z. B. wenn jemand zu Ihnen sagt: „Ich kann das nicht.“ Sie korrigieren den Satz auf „Ich kann das NOCH nicht“ und bieten dem entsprechenden Gegenüber direkt mehr Zeit für gemeinsames Üben oder Einarbeitung an. Ein anderer Weg ist ein „Debriefing“ nach Aufgaben.
Beim Debriefing geht es um die Selbstreflexion der Mitarbeiter. Diese sollen im Nachgang beurteilen, was am besten umgesetzt wurde, wie Stärken bestmöglich eingebracht wurden, wo sich außerhalb der Komfortzone bewegt wurde und wie sich beim nächsten Mal noch weiter herausgefordert werden kann. Dies hilft, das Selbstbewusstsein der GenZ zu stärken und aufzuzeigen, wo sie aktuell im Lernprozess stehen.
Fazit
Die richtige Kommunikation und Verständigung zwischen Generationen ist unabdingbar für den Unternehmenserfolg. Alle Mitarbeiter sind individuell mit ihren Erfahrungen und Erlebnissen zu behandeln, unabhängig von ihrer zugehörigen Generation. Die Generationslehre zeigt jedoch klare Tendenzen, wie Kommunikation und Führung erfolgreich gelebt werden können.
Headerbild: © Stock 4 You – stock.adobe.com